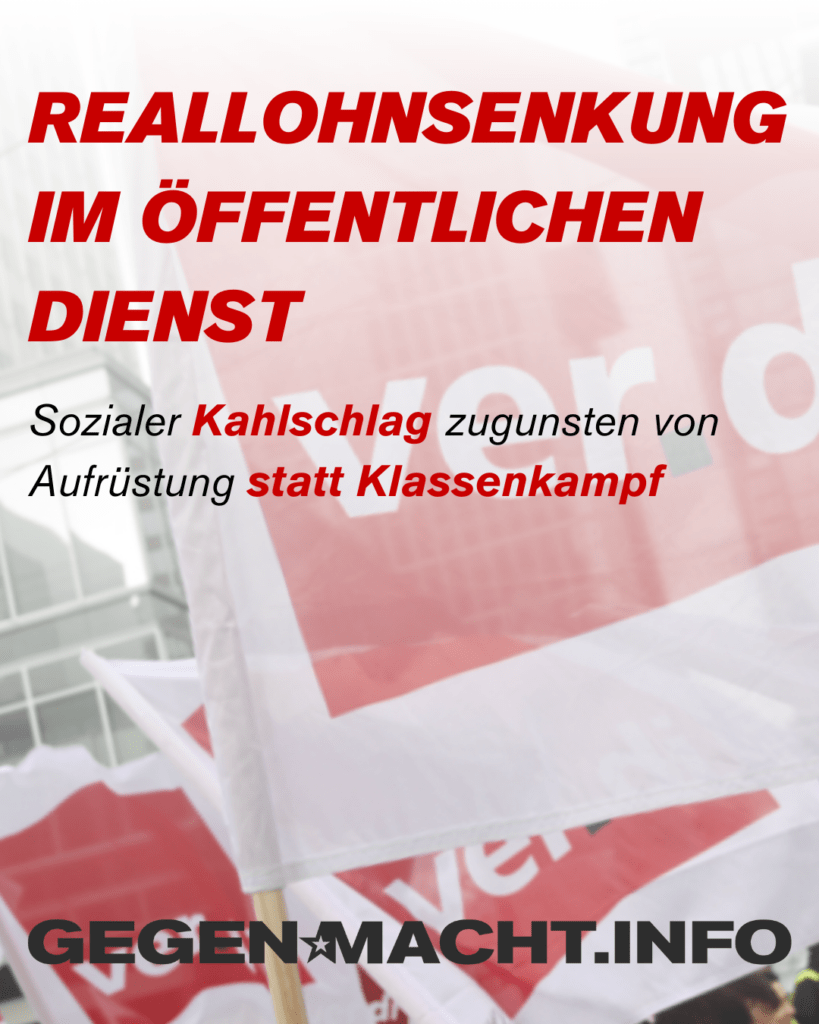Sozialer Kahlschlag zugunsten von Aufrüstung statt Klassenkampf
Nach monatelangen Tarifverhandlungen und mehreren bundesweiten Warnstreiks mit Hunderttausenden Beschäftigten im öffentlichen Dienst liegt nun ein Schlichtungsvorschlag vor – mit dramatischen Konsequenzen für die Arbeiter:innenklasse. Die Gewerkschaft ver.di hatte ursprünglich acht Prozent mehr Lohn gefordert, um die massiven Kaufkraftverluste durch die Inflation auszugleichen, ebenso wie drei weitere Urlaubstage.
Doch der nun vorgelegte Kompromiss sieht lediglich eine stufenweise Erhöhung von drei Prozent ab dem 01.04.2025 und weiteren 2,8 Prozent ab Mai 2026 vor – was angesichts der aktuellen Preissteigerungen faktisch eine Reallohnsenkung bedeutet. Zusätzlich sollen die Beschäftigten ab 2026 eine etwas höhere Jahressonderzahlung erhalten, welche in drei zusätzliche freie Tage umwandelbar sein soll, wobei davon Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ausgenommen sein sollen. Doch diese kosmetischen Zugeständnisse ändern nichts am Kernproblem: Die Löhne werden weiter hinter der Inflation zurückbleiben.
Zusätzlich soll die Möglichkeit eingeführt werden, die Arbeitszeit „freiwillig“ zu verlängern – ein scheinbar flexibles Angebot, das in der Praxis jedoch vor allem Druck auf die Belegschaften ausüben wird, da viele aufgrund der sinkenden Reallöhne gezwungen sein werden, mehr zu arbeiten. Dieser Schlichterspruch ist kein betriebswirtschaftliches Zugeständnis, sondern eine politische Entscheidung, die im Kontext der massiven Aufrüstung und neoliberalen Krisenpolitik verstanden werden muss.
Während die Bundesregierung behauptet, für angemessene Löhne im öffentlichen Dienst fehle das Geld, werden gleichzeitig Milliarden in Rüstungsprojekte und die Aufstockung der Bundeswehr gepumpt. Die Grundgesetzänderung, mit der die Umschiffung der Schuldenbremse um 500 Milliarden Euro zugunsten von Militarisierung und Aufrüstung auf den Weg gebracht wurde, steht in krassem Gegensatz zur chronischen Unterfinanzierung von Schulen, Krankenhäusern und sozialer Infrastruktur.
Die Botschaft dahinter könnte klarer nicht sein: Der Staat priorisiert Kriegsvorbereitung höher als die Lebensbedingungen der arbeitenden Klasse. Dass Friedrich Merz den Schlichtungsvorschlag ausdrücklich begrüßt – mit dem Hinweis, es sei „endlich wieder von Arbeitszeitverlängerung die Rede“ –, unterstreicht, worum es wirklich geht: Eine weitere Verschärfung der Ausbeutung zugunsten von Konzernprofiten und Aufrüstung. Während Rüstungskonzerne wie Rheinmetall Rekordgewinne einfahren, soll die Arbeiter:innenklasse die Krisenlast tragen.
Dabei gehen dem Staat jährlich allein durch Steuerflucht und -vermeidung von Superreichen und Konzernen schätzungsweise über 100 Milliarden Euro verloren – Geld, das dringend gebraucht wird, um beispielsweise marode Schulen technisch angemessen auszustatten, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, ernstzunehmende Maßnahmen gegen die sich stetig verschärfende Klimakrise zu ergreifen oder auch bezahlbaren Wohnraum zu subventionieren.
Die Gewerkschaften stehen nun vor einer entscheidenden Weichenstellung. Soll dieser Schlichterspruch akzeptiert werden, obwohl er eine weitere Schwächung der Arbeiter:innenposition bedeutet? Oder ist es an der Zeit, die Funktion ebenso wie die Wirkungsweise der gewerkschaftlich etablierten Sozialpartnerschaft als kapitalistisches Druckmittel infrage zu stellen und den Kampf um höhere Löhne mit einer grundsätzlichen Systemkritik zu verbinden? Die Reallohnsenkung im öffentlichen Dienst ist kein isoliertes Phänomen, sondern Teil einer europaweiten Offensive reaktionärer Kräfte, die soziale Errungenschaften abbaut und gleichzeitig die Militarisierung vorantreibt. In Frankreich, Griechenland, Italien und anderen Ländern finden ähnliche Angriffe statt – immer mit derselben Begründung: Es gebe „kein Geld“, während gleichzeitig Rüstungskonzerne subventioniert, europäische Außengrenzen hochgerüstet und Steuergeschenke für Reiche verteilt werden.
Die Antwort auf diese Entwicklung kann nur in einer radikalen Politisierung der Gewerkschaftsbewegung bestehen, die über rein tarifpolitische Forderungen hinausgeht. Es gilt, durch die Organisation von Arbeitskämpfen nicht nur höhere Löhne durchzusetzen, sondern die gesamte Krisenpolitik des Kapitals fundamental in Frage zu stellen. Dafür muss eine offensive Verbindung zwischen gewerkschaftlichen Kämpfen und politischen Forderungen hergestellt werden – etwa durch die Forderung nach der Schließung von Steuerschlupflöchern und der konsequenten Besteuerung von Superreichen, der Streichung der Milliardensubventionen für die Aufrüstung sowie der Verstaatlichung von Krisenprofiteuren. Entscheidend wird dabei sein, die Vorbereitung politischer Streiks gegen den Sozialabbau voranzutreiben, die über den Rahmen betrieblicher Auseinandersetzungen hinausgehen. Nur durch eine solche offensive Verbindung von ökonomischen und politischen Kämpfen lässt sich verhindern, dass die Krisenlast einseitig auf die Arbeiter:innenklasse abgewälzt wird.
Die aktuelle Schlichtung zeigt erneut: Solange die Logik des Kapitals mit ihrer Umverteilung von unten nach oben nicht grundsätzlich infrage gestellt wird, bleibt jeder vermeintliche „Kompromiss“ in Wahrheit eine Niederlage für die Arbeiter:innenklasse. Es ist höchste Zeit, diese zerstörerische Logik endlich zu durchbrechen und den Kampf um bessere Löhne mit dem Kampf für eine grundlegend andere Gesellschaft zu verbinden. Die organisierte Arbeiter:innenbewegung muss darauf mit entschlossenem Widerstand antworten.